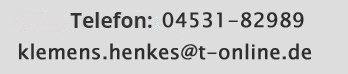Der Anfang

- Was wird da gemacht?
Die propagierten Prüfmethoden suggerieren und erzwingen dann einen sehr hohen Sanierungsbedarf. In Wirklichkeit sind nur sehr wenige private Leitungen undicht - Muss das sein?
Nein ! Die häuslichen Abwässer bestehen zu 95% aus Trinkwasser, sie verunreinigen kein Wasser - Was wir wollen
Wir fordern die schleswig-holsteinische Regierung auf, keine Prüfpflicht (Zwangskontrolle) für private Leitungen zu beschließen. - Was wir tun
Wir wollen alle ca. 426000 Hausbesitzer in Schleswig-Holstein informieren und zu gegebenen Zeitpunkt zu Aktionen (z. B. Schreiben an die Regierung) animieren.
Für unsere häuslichen Abwasserleitungen gilt:
- Prüfverfahren und - kosten = unverhältnismäßig
- Gefährdung der Umwelt und des Grundwassers = 0
- wirtschaftlicher Nutzen durch absolut dichte Leitung =
unbedeutend
Stellungsnahme zur Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen.
"Es gibt eine EU-Richtlinie, wonach alle Abwasserleitungen bis 2015 und danach alle 20 Jahre auf ihre Dichtheit überprüft werden sollen.
Die dafür notwendigen gesetzlichen Durchführungsbestimmungen zu erstellen ist Aufgabe der einzelnen Bundesländer."
Das kann in den Bereich der Legenden abgelegt werden.
Es gibt keine europäische Richtlinie zur Dichtheitsprüfung.
Es gibt eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates die vorschreibt, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers ergreifen mögen. Maßnahmen zur Prüfung von Abwasserleitungen schreibt sie keinesfalls vor.
Trotzdem will die schleswig-holsteinische Landesregierung eine Zwangskontrolle auch privater Abwasserleitungen gesetzlich festschreiben.
Wenn private Leitungen geprüft werden sollen, wie gestaltet sich das Prüfverfahren, welchen Kriterien müssen die Leitungen diesbezüglich entsprechen?
Es ist davon auszugehen, dass jeder Hausbesitzer von sich aus die ordentliche Funktion seiner Abwasserleitung überwacht, denn die Folgen einer schadhaften Leitung betreffen ihn selbst und unangenehm direkt; Er wird einen Schaden schnellstmöglichst beseitigen lassen.
Das sieht auch der niedersächsische Umweltminister Hans-Heinrich Sander so, der lt. Mitteilung des Hamburger Abendblatts vom 27.03.09 erklärte: „Nach erneuter Prüfung der Rechtslage haben wir festgestellt, dass die auf EU-Ebene festgelegte Norm in Niedersachsen keine Bürger mit privaten Leitungen betreffen wird, wir beschränken uns auf die Überprüfung der öffentlichen Leitungen“.
Diese Entscheidung erspart im Übrigen den Kommunen einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand für die Zwangskontrollen. Würde unsere Landesregierung eine gleiche Entscheidung treffen, wären die folgenden Ausführungen nicht mehr so entscheidend.
Trotz dieser ministeriellen Entscheidung sind auch in Niedersachsen weiter Interessenverbände aktiv, um in den Kommunen Abwassersatzungen für Zwangskontrollen einzuführen, was in einzelnen Gemeinden auch erfolgte.
Bei der Beurteilung von Prüfverfahren sind diese technischen Gegebenheiten zu berücksichtigen:
Eine normale Hausabwasserleitung besteht aus Keramik- oder Kunststoffrohren mit einem Innendurchmesser von 100 oder 125 mm. Sie ist keine Druckleitung.
Das Abwasser, das zu über 95% aus Trinkwasser besteht, fließt in einem Gefälle von 2 bis 5% und „füllt“ nur einige cm im Sohlbereich der Rohre.
Die z.Zt. von Interessenverbänden und Kommunen propagierten Prüfverfahren sind entweder optische Kontrollen oder Druckprüfungen oder Beides zusammen.
Die optische Kontrolle erfordert hohen technischen Aufwand:
Zuerst wird mit einer Hochdruckspülanlage (100-150 bar!) die Leitung „gründlich gereinigt“! Das hält kaum eine Fugendichtung aus, besonders nicht in den nie benetzten ausgetrockneten oberen Zweidrittel des Rohrumfangs.
Dann erfolgt eine Befahrung mit einer ferngesteuerten hochauflösenden Dreh- und Schwenkkamera einschließlich Ortungssender zur Lagebestimmung. Diese Kamera „erkennt jeden Haarriss“. Es wird eine CD oder DVD angefertigt, Lagepläne mit detaillierten Lage- und Höhenangaben erstellt. Protokolle ergänzen die Dokumentation.
Die Entscheidung Dicht oder Nichtdicht obliegt dem zertifizierten Fachbetrieb.
Im Zweifelsfall oder bei Einsprüchen erfolgt eine Druckprüfung (z.B. nach DIN 1610).
Hierbei wird das Leitungssystem mit Rohrblasendichtungen an den Enden abgesperrt, komplett mit Wasser gefüllt, ein Überdruck von mind. 1 m Wassersäule aufgebracht und nach einer halben Stunde der Wasserverlust gemessen. Dieser darf bei den üblichen Leitungen weniger als 0,5% des Volumens nicht überschreiten.
Das gilt auch für Schächte!
Bei diesem Prüfverfahren ist es kein Wunder, wenn damit gerechnet wird, dass mindestens 70% aller Leitungen den geforderten Kriterien nicht entsprechen.
Das kann man nach wie vor so der von unseren Stadtwerken propagierten website entnehmen, die Druckprüfung nach DIN 1610 wird grundsätzlich fällig, wenn mehr als die Hälfte der Leitung saniert werden muss.
Die Stadtwerke sind auch nur mit der Druckprüfung einverstanden, die hat aber, wenn überhaupt, bei der Abnahme von Neubauten einen Sinn, Fachleuten zufolge gibt es dabei aber auch viele negative Ergebnisse.
Das Ministerium empfiehlt entweder optische Kontrolle oder Druckprüfung,
wobei ich mich frage wie bei einer optischen Prüfung die Dichtheit einer Muffenverbindung festgestellt werden kann. Die Druckprüfung soll nach DIN 1986 Teil 30 erfolgen.
Hierbei ist kein Überdruck erforderlich, das Rohr muss aber voll gefüllt sein.
Der zulässige Wasserverlust darf in 15 min 0,4% nicht überschreiten.
Das wird auch kaum einzuhalten sein.
Außerdem führt jede Art von Druckprüfungen zu unrealistischen Ergebnissen, da eventuelle Undichtigkeiten, die sich durch Ablagerungen verschlossen haben dadurch wieder aufgebrochen werden können.
Dann wechselt der Fachbetrieb von der Prüfung zur Durchführung der Sanierung.
Dazu schreibt das Ministerium:
„Die zu erfolgende Sanierung muss nicht zwangsläufig durch den untersuchenden Fachbetrieb durchgeführt werden. Der Grundstückseigentümer kann sich eine neue Fachfirma aussuchen, wenn er möchte.“
Hierbei ist festzustellen, dass dann die komplette Erneuerung des unterirdischen Leitungssystems einschließlich der Schächte noch die billigste Lösung ist.
Bei Leitungen die unter dem Gebäude verlaufen erfordert dies das Aufstemmen der Kellersohle. Um das zu vermeiden, muss man entweder auf einen drucklosen direkten Anschluss von zu entwässernden Objekten wie WC und Dusche verzichten und Pumpen einbauen, oder die vorhandene Leitung mit aufwendigen Inliner-Systemen sanieren lassen. (Spülen, Trocknen, Einziehen von mit Epoxydharz getränkten Textilschläuchen, mit Druckluft aufblasen, Erwärmen zwecks Erhärtung, Anschlüsse).
Diese Sanierungsmethode muss auch dort angewendet werden, wo das Aufgraben der Leitung aufgrund örtlicher Verhältnisse nicht möglich, nicht erwünscht, oder noch teurer würde. Beispiele dafür sind : Unterquerung von Stützmauern, Gartenpavillons, Gartengestaltung, Pflanzen- und Baumbestand, größere Tiefe.
Diese Prüf- und Sanierungsmaßnahmen erzwingen nicht nur eine Beeinträchtigung des Haus- und Grundstückbetriebs, sie sind auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.
Nach Angaben von Fachvertretern liegen die Prüfkosten bei 400,- bis 1100,-€.
Sanierung kostet um die 300,-€ pro m Leitung.
Einen Kontrollschacht „normgerecht“ zu sanieren kostet mind. 1000,-€
Bei einer Leitung bis 10 m ergeben sich für ein Einfamilienhaus Kosten von ca. 4.400,- €.
Für Bad Oldesloe mit ca. 5.500 Einfamilienhäusern bedeutet dies, dass von den
Hausbesitzern bei einem Sanierungsbedarf von 80% mindestens 20 Millionen zu erbringen sind.
Ich möchte Ihnen am Beispiel meines Hauses zeigen, welcher Aufwand da auf mich zukommt, und wie ein evt. notwendiger günstiger Neubau sich auswirken würden:
Baujahr 1968
Grundleitung unter Haus
Nicht genutzter Waschküchenablauf
Große Tiefe
Unterquerung Stützmauern
Kein Fremdwassereintrag (Höhenlage)
Neue Leitung innen an Kellerwand, 4 Mauerdurchbrüche
Zusätzlicher Fallschacht
3 Reinigungsöffnungen in den Ecken, immer zugänglich
für WC, Dusche im Keller Pumpanlage
Kosten Sanierung: 15-20 Tsd €
Kosten Neubau: 10-15 Tsd €
Solche Kosten sind unverhältnismäßig und nicht zumutbar!
Dazu stellt sich die Frage, um welche mögliche Verunreinigung des Grundwassers geht es eigentlich.
Ein Einfamilienhaushalt mit 2 – 4 Personen verbraucht im Jahr unter 100 cbm Wasser, das sind 270 Liter pro Tag. Die Menge der Fäkalien und (immer umweltfreundlicheren) Reinigungsmitteln wird unter 5 Liter pro Tag sein, wobei feste Fäkalien auf dem Abwasser schwimmen und bei ihrer Auflösung längst das öffentliche Kanalsystem erreicht haben. Der Verschmutzungsgrad des häuslichen Abwassers bewegt sich also um 1%.
In einer langjährig bestehenden Leitung wird die Rohrdichtung im Sohlbereich dicht sein, da sie immer feucht gehalten wird, und selbst bei leichter Durchwurzelung entstehende Risse sich dicht setzen.
Ergänzen möchte ich das noch durch Feststellungen von Tiefbauingenieuren die mir geschrieben haben:
„Evtl. austretendes Abwasser bildet eine mineralische, wasserdichte Verkrustung, sodass kein weiteres Abwasser austreten kann. Diese Verkrustungen kannte man früher von Misthaufen auf Bauernhöfen, diese Schicht hat ein Eindringen von Flüssigkeiten ins Erdreich verhindert. Auch in Abwasserrohren findet man im Sohlbereich eine harte, dichte und spröde Ablagerung, die eine Abdichtung bewirkt.“
Sollte hier doch noch wenig Abwasser austreten wird es unser Grundwasser nicht erreichen, denn das ist durch Mergelschichten gut geschützt.
Im übrigen kommt das Trinkwasser in Bad Oldesloe wie auch in anderen Bereichen Stormarns aus eiszeitlichen Reservoiren, deren höchster Wasserspiegel immerhin noch in 16 m Tiefe liegt.
Eine Verschmutzungsgefahr ist also gleich Null.
Nun wird vom Ministerium ein zweiter Grund außer dem Umweltschutz für die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung angeführt, die Wirtschaftlichkeit.
Ich habe diesen Punkt in meiner Stellungnahme nicht erwähnt, weil ich ihn einfach lachhaft finde.
Es geht hier um den sog. Fremdwassereintrag, d.h. in Leitungen eindringendes Frischwasser. Dies führe zur Erhöhung der Kosten für die Klärung des Abwassers.
Ich habe darauf wie folgt geantwortet:
Die Differenz zwischen durch Gebühren abgerechneter Abwassermenge und der tatsächlichen in der Kläranlage gereinigten Menge beträgt in Bad Oldesloe ca.20%. Es ist bekannt, dass die Ursache dieser Differenz zu einem Großteil im öffentlichen Leitungsnetz zu suchen ist. Das sind u.A. nicht wasserdichte Kanaldeckel, Direktanschlüsse einzelner Straßeneinläufe und notwendige Spülungen. Zu dem kleineren Teil der Differenz könnten dann Fehler in den Hausleitungen beitragen. Die hier in Frage kommenden Privathaushalte verursachen unter 40% der Abwassermenge. Das Kosteneinsparungspotential durch absolute Dichtheit dieser Leitungen beträgt also um die 3%, für den einzelnen Haushalt ein einstelliger €-Betrag im Jahr.
Es sollte also der Hauseigentümer nach wie vor eigenverantwortlich seine Abwasserleitung den bestehenden Gesetzen entsprechend in Schuss halten und keiner Zwangskontrolle unterliegen.
Wird eine Kontrolle notwendig, dann müssen vernünftige und verbindliche Maßstäbe für das Bestehen einer Dichtheitsprüfung festgelegt werden. Am ehrlichsten und einfachsten wäre es z.B. eine normale maximale Durchflussmenge (WC-Spülung, laufende Dusche, Waschmaschine) zu kontrollieren: Man gibt oben 25 Liter Wasser ein und misst am Kontrollschacht was ankommt. Sollte es da erkennbare Abweichungen geben, kann dann eine optische Kontrolle aufzeigen wo eine Zerstörung der Leitung vorliegt, und nur da muss saniert werden.
Die schleswig-holsteinische Landesregierung ist aufgefordert, in dieser Sache eine bürgerfreundliche und vernünftige Lösung zu beschließen, am Besten so wie in Niedersachsen.
Das habe ich so im September vergangenen Jahres unserem Landtagsabgeordneten geschrieben: Es geht mir um die Verhältnismäßigkeit, wohl wissend dass es durchaus auch Sanierungsfälle gibt.
Jedes Haus, das auch vor 50 Jahren hier gebaut wurde, hat ein Genehmigungsverfahren hinter sich (Bauantrag, Genehmigung, Abnahme). Ein Entwässerungsplan ist dabei notwendiger Bestandteil, d.h., das Stadtbauamt weiß schon wo Sanierungsbedarf besteht, warum müssen Alle dafür in Haftung genommen werden.
Und was nutzt ein Prüfintervall von 20 Jahren, eine im Jahr 1 nach der Prüfung - wodurch auch immer - zerstörte Leitung muss sofort in Verantwortung des Hauseigentümers repariert werden, und nicht erst in 19 Jahren.
Bad Oldesloe, den 29.09.2009
Klemens Henkes
Aktualisiert 01.03.2010